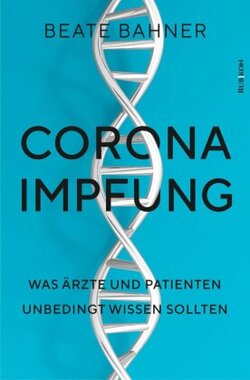Offenbar wurden an der britischen Transgenderklinik Tavistock Jugendliche mit Pubertätsblockern behandelt, die schwere Nebenwirkungen aufweisen. Nun wird das Zentrum nicht nur geschlossen – es drohen auch Tausende Klagen von Geschädigten.
Ehemalige Patienten der umstrittenen NHS-Klinik für Geschlechtsidentität bei Kindern können nun gerichtlich gegen diese Klinik vorgehen. Tausende von jungen Menschen wurden im Tavistock-Zentrum im Norden Londons behandelt – und in vielen Fällen wurden ihnen starke Medikamente verschrieben, um den Beginn der Pubertät hinauszuzögern. Doch nun hat der NHS, die britische Gesundheitsbehörde, die Schließung des Zentrums angeordnet, nachdem ein vernichtender Bericht festgestellt hat, dass Teenager darunter leiden, dass sie auf eine Behandlung warten müssen. Die Sachverständige, die die Untersuchung durchführte, warnte auch vor den potenziell schwerwiegenden Nebenwirkungen der “Pubertätsblocker”.
Dr. Hilary Cass erklärte dem NHS England, man wisse nicht, ob die Medikamente den Prozess der Entscheidung der Kinder über ihre Geschlechtsidentität “stören” könnten, anstatt ihnen “Zeit zu verschaffen”. Sie äußerte auch die Befürchtung, dass die Medikamente den Reifungsprozess des Gehirns unterbrechen und damit die Urteilsfähigkeit der Kinder beeinträchtigen könnten. Ihre Ergebnisse lassen erwarten, dass die in Tavistock behandelten Patienten und ihre Eltern nun den NHS auf Schadenersatz verklagen könnten. Sie könnten versuchen zu beweisen, dass sie durch die Medikamente geschädigt wurden, von denen das Personal des Zentrums behauptet haben soll, sie seien trotz fehlender Beweise “vollständig reversibel”. Die Patienten könnten auch geltend machen, dass sie nicht in Kenntnis der Sachlage in die Einnahme der Medikamente hätten einwilligen können, da sie nichts über deren langfristige Auswirkungen wussten.
Im Zuge der Ausbreitung der Gender-Ideologie, die auch insbesondere von sogenannten “progressiven” (also eher linken und linksliberalen) Regierungen unterstützt wird, verbreiten sich solche Ideen zunehmend unter den Kindern und Jugendlichen. Dies wird auch aus den Zahlen deutlich, die der NHS England veröffentlichte: Waren es 2011/2012 etwa 250 Überweisungen zu solchen “Geschlechtsidentitätsdiensten”, explodierten die Zahlen bis zum Zeitraum 2021/2022 auf mehr als 5.000. Die Zahl der Überweisungen an den Gender Identity Development Service (GIDS) des Landes ist vor allem bei Mädchen in die Höhe geschnellt. Der NHS selbst weist darauf hin, dass eine hohe Zahl dieser Kinder unter zusätzlichen psychischen Problemen und Risikoverhalten leidet.
Im Februar 2021 wurde in der Fachzeitschrift PLOS One eine Studie veröffentlicht, die zeigte, dass die Verwendung von Pubertätsblockern das Knochenwachstum von Kindern, die mit ihnen behandelt wurden, deutlich beeinträchtigte. Die Studie verfolgte eine Kohorte von 44 Jugendlichen, die sich der experimentellen Behandlung in der NHS-Gender-Klinik des Vereinigten Königreichs unterzogen hatten. “In beiden Fällen (Körpergröße und Knochenstärke) gab es ein gewisses Wachstum, das jedoch geringer ausfiel, als in den Jahren ohne hormonelle Unterdrückung zu erwarten gewesen wäre”, heißt es in der Studie, so der NHS. Die Forschungsergebnisse wurden neun Jahre nach Beginn der Studie veröffentlicht. Von den 44 Kindern, die im Rahmen der Studie beobachtet wurden, nahmen 43 anschließend geschlechtsübergreifende Hormone ein.
So kann man durchaus zu dem Schluss kommen, dass solche experimentellen “Behandlungen” von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen mehr Schaden verursachen, als dass sie einen konkreten Nutzen hätten. In der Cass-Überprüfung wird nämlich auch darauf hingewiesen, dass die Evidenzbasis für den Einsatz von Medikamenten zur Unterbrechung der natürlichen Pubertät bei geschlechtsdysphorischen Kindern dürftig ist und die Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung hervorgehoben: “Die Gehirnreifung kann durch Pubertätsblocker vorübergehend oder dauerhaft gestört werden, was erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit haben könnte, komplexe, risikobehaftete Entscheidungen zu treffen, sowie mögliche längerfristige neuropsychologische Folgen”.