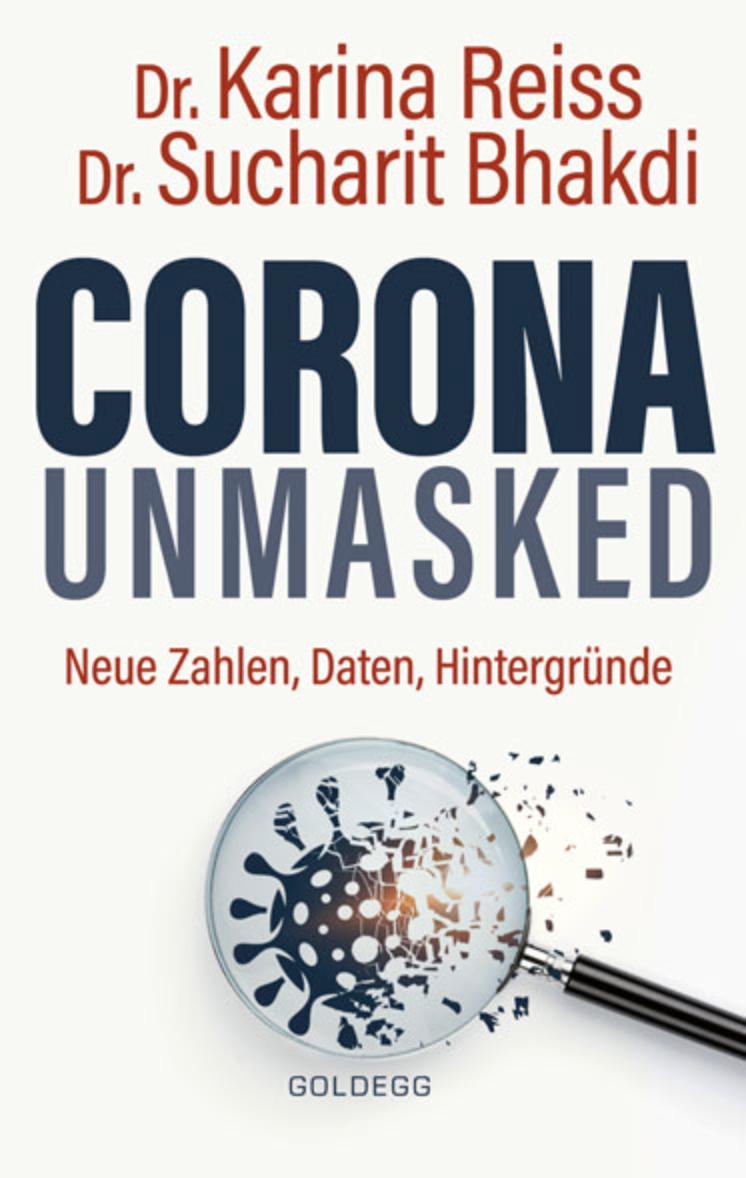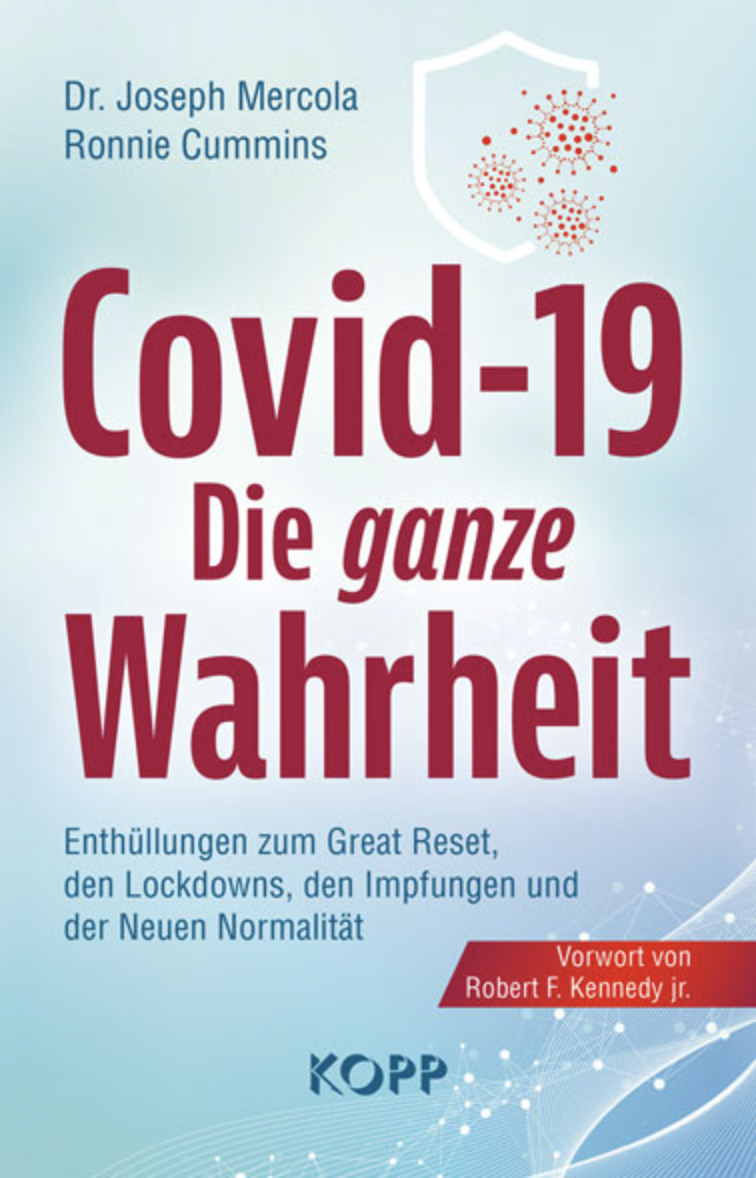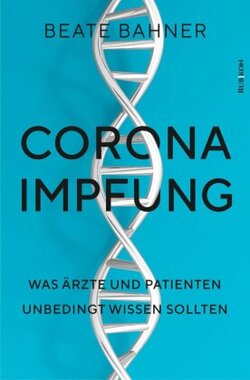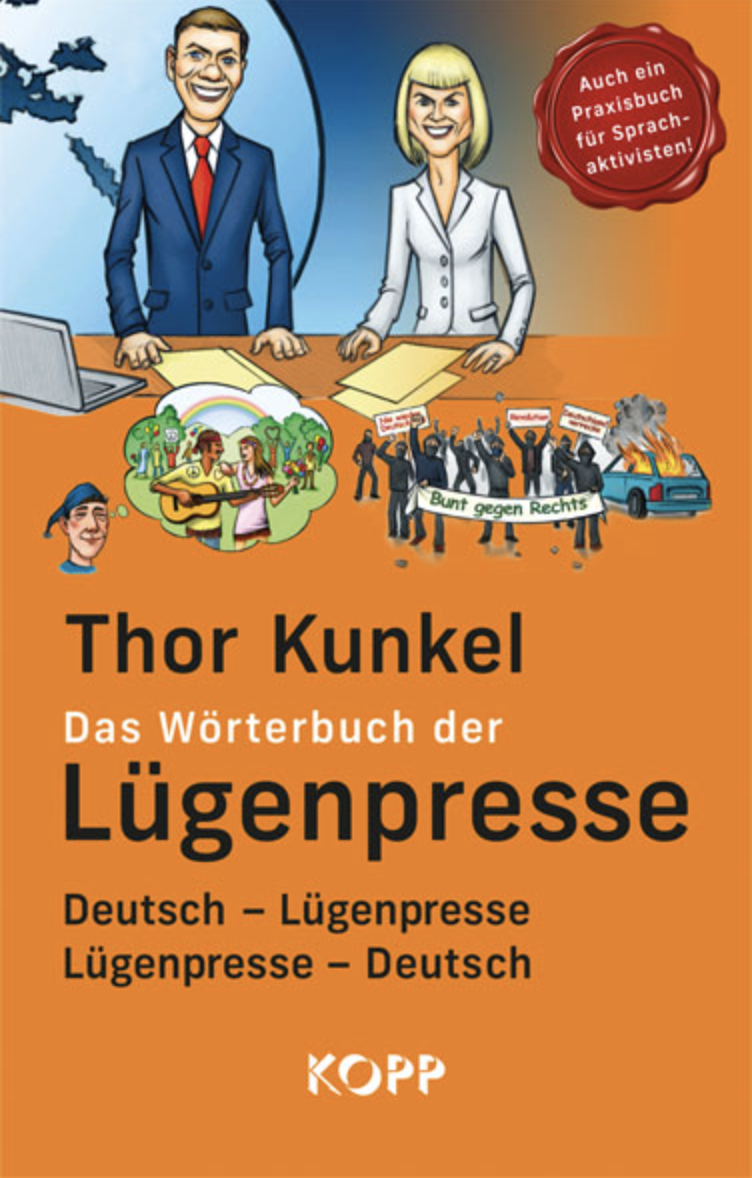Wäre es eigentlich nicht an der Zeit, das Fossil des Kalten Krieges, die NATO, endgültig abzuwickeln und eine neue, moderne Sicherheitsarchitektur für Europa zu entwickeln? Gerade der Ukraine-Krieg verdeutlicht, warum Europa sowohl mit Washington als auch mit Moskau konstruktive Beziehungen pflegen sollte.
Ein Kommentar von Heinz Steiner
Die vergessene Vorgeschichte des Konflikts
In der aktuellen Debatte um den Ukraine-Konflikt wird ein entscheidender Faktor oft übersehen: Die Rolle der NATO als treibende Kraft hinter der Eskalation. Während Donald Trump während seiner Präsidentschaftskampagne wiederholt von einem “geheimen Plan” zur Beendigung des Krieges sprach, steht sein Team nun vor einer komplexen Realität, in der die transatlantische Militärallianz das größte Hindernis für eine dauerhafte Friedenslösung darstellt.
Die westlichen Mainstream-Medien beginnen ihre Erzählung typischerweise mit der russischen Invasion – als sei dies der Ausgangspunkt des Konflikts. Diese verkürzte Darstellung ignoriert jedoch die jahrzehntelange Vorgeschichte, die für das Verständnis der aktuellen Situation unerlässlich ist.
Nach dem Ende des Kalten Krieges hätte die NATO dem Warschauer Pakt folgen und sich auflösen können. Stattdessen begann die Allianz eine aggressive Osterweiterung, die letztlich zur Wurzel des heutigen Konflikts wurde. Diese Expansion erfolgte trotz wiederholter Zusicherungen westlicher Politiker gegenüber Moskau, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen würde.
Das gebrochene Versprechen
“Die NATO wird sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen” – diese Zusage erhielt die russische Führung nach dem Fall der Berliner Mauer. Die Realität sah anders aus: Polen, Ungarn, die baltischen Staaten und andere ehemalige Warschauer-Pakt-Mitglieder wurden sukzessive in die Allianz integriert, wodurch NATO-Truppen, -Raketen und -Infrastruktur immer näher an die russische Grenze rückten.
Besonders brisant: Deutschland, das im 20. Jahrhundert zweimal verheerende Kriege gegen Russland führte, wurde Teil dieser Ostexpansion. Aus russischer Perspektive musste dies als existenzielle Bedrohung erscheinen – vergleichbar mit einer hypothetischen Situation, in der Russland Militärbündnisse mit Mexiko oder Kuba eingehen würde.
Der sicherheitspolitische Komplex Amerikas
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlor der amerikanische Sicherheitsapparat – Pentagon, CIA und NSA – seinen Hauptfeind. Die Folge war eine verzweifelte Suche nach neuen Bedrohungsszenarien: zunächst der “Krieg gegen Drogen”, dann die Dämonisierung des ehemaligen Verbündeten Saddam Hussein und schließlich der “Krieg gegen den Terror” nach den Anschlägen vom 11. September.
Doch die Verlockung, Russland erneut zum offiziellen Gegner zu erklären, blieb bestehen. Die tief verwurzelte antirussische Stimmung in der amerikanischen Gesellschaft bot den perfekten Nährboden für einen neuen Kalten Krieg – und damit für neue Militärbudgets und erweiterte Befugnisse für den Sicherheitsapparat.
Die Ukraine als Schlüssel zum Verständnis
Russland hatte wiederholt und unmissverständlich klargestellt, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine eine rote Linie darstelle. Als die Allianz dennoch mit einer möglichen Aufnahme des Nachbarlandes kokettierte, reagierte Moskau genau so, wie es angekündigt hatte: mit einer Invasion.
Rechtlich betrachtet war dies zweifellos eine Aggression. Die Ukraine hatte das souveräne Recht, einem Militärbündnis ihrer Wahl beizutreten. Doch die praktische Realität internationaler Sicherheitspolitik folgt anderen Gesetzen. Die amerikanische Führung wusste genau, welche Reaktion sie mit der NATO-Erweiterung provozieren würde – ähnlich wie die USA selbst reagiert hätten, wenn Russland Militärstützpunkte in Kuba errichten würde.
Das Dilemma einer Friedenslösung
Hier liegt das zentrale Problem für jede Friedensinitiative: Wie kann Russland garantiert werden, dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird? Trumps Versprechen allein reichen nicht aus – zu oft hat die amerikanische Außenpolitik bewiesen, dass Zusagen gebrochen werden können. Selbst ein schriftliches Abkommen bietet keine Sicherheit, wenn ein künftiger Präsident es ignorieren kann.
Die einzige verlässliche Garantie wäre die vollständige Auflösung der NATO – ein Schritt, der die Bedrohungswahrnehmung Russlands fundamental verändern würde. Ohne NATO gäbe es keine Gefahr einer plötzlichen Aufnahme der Ukraine oder weiterer Staaten an Russlands Grenzen.
Die Chancen für eine solch radikale Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur stehen jedoch schlecht. Der militärisch-industrielle Komplex und die etablierten außenpolitischen Eliten in Washington haben kein Interesse an der Auflösung eines Bündnisses, das ihnen Macht, Einfluss und finanzielle Vorteile sichert.
Solange die NATO als Relikt des Kalten Krieges weiterbesteht, bleibt ein dauerhafter Frieden in der Ukraine eine Illusion. Die wahre Herausforderung für Trump und künftige Friedensinitiativen liegt nicht in diplomatischen Formulierungen, sondern in der Bereitschaft, die grundlegenden Strukturen zu hinterfragen, die den Konflikt erst möglich gemacht haben.