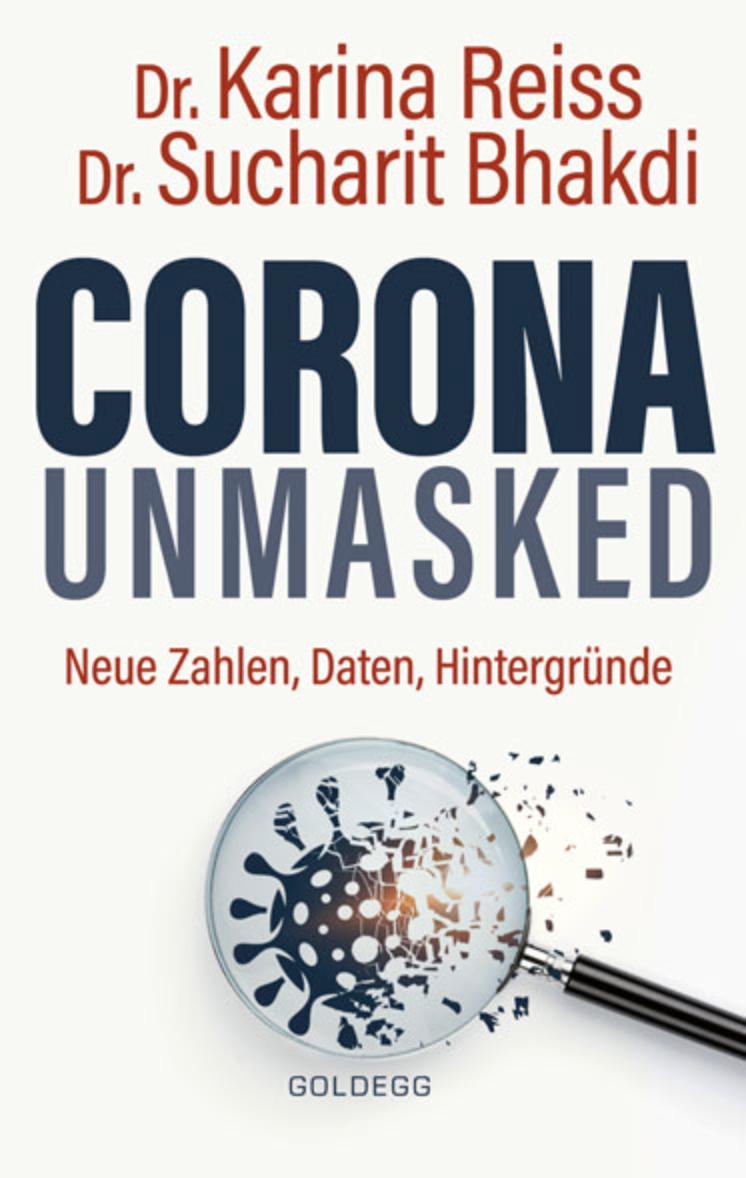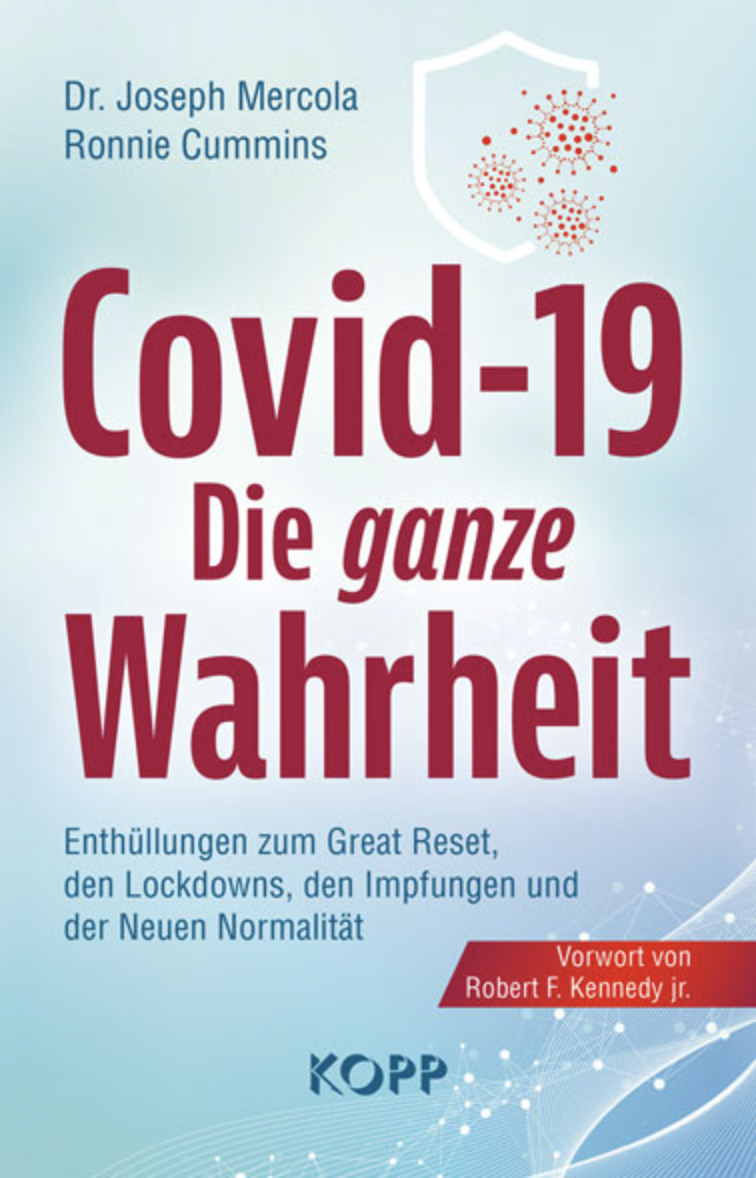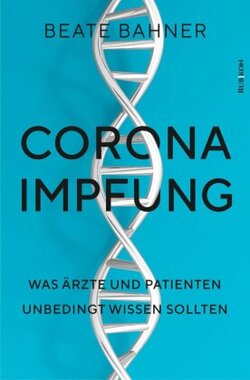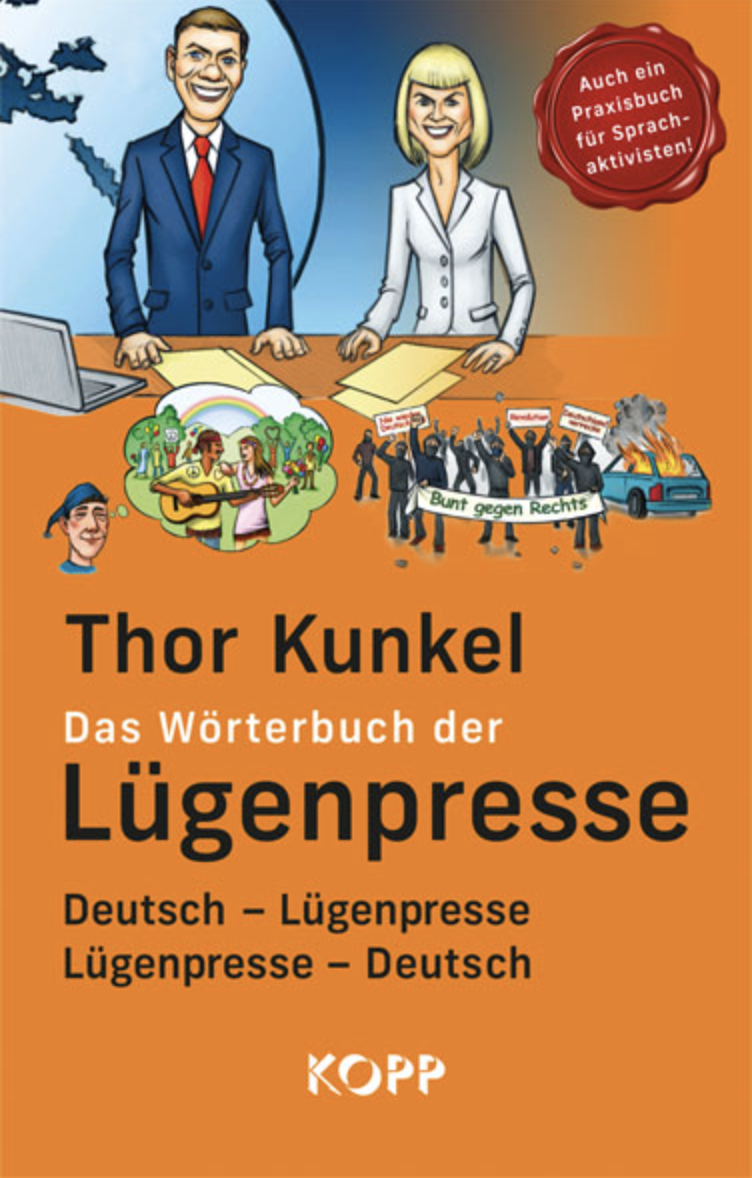Während sich der Herbst in Deutschland ankündigt, zeichnet sich am anderen Ende der Welt ein Wetterphänomen ab, das möglicherweise weitreichende Folgen für den kommenden Winter in Europa und Nordamerika haben könnte. La Niña, die kühlere Gegenspielerin des El Niño, steht vor einer möglichen Rückkehr. Wird dieser Winter besonders kalt und schneereich?
Laut aktuellen Prognosen des Climate Prediction Center des US-amerikanischen National Weather Service besteht eine 71-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sich La Niña zwischen September und November 2024 entwickeln wird. Die Experten schätzen zudem, dass die Bedingungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent bis in den Februar 2025 hinein anhalten könnten. La Niña zeichnet sich durch ungewöhnlich kalte Meeresoberflächentemperaturen entlang des Äquators im Pazifischen Ozean aus. Dieses Phänomen verstärkt die Passatwinde, was dazu führt, dass wärmeres Wasser in Richtung Asien gedrängt wird, während an den Küsten Amerikas kälteres Wasser aufsteigt.
La Nina is favored to emerge in September-November (71% chance) and is expected to persist through January-March 2025. A #LaNina Watch remains in effect. #ENSO https://t.co/5zlzaZ0D9Z pic.twitter.com/tkEs5EMBzw
— NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) September 12, 2024
Die Auswirkungen auf Nordamerika sind relativ gut erforscht. Typischerweise führt La Niña zu trockeneren und wärmeren Wintern im Süden der Vereinigten Staaten, während der Norden der USA und Kanada oft kältere und feuchtere Bedingungen erleben. Diese Veränderungen können erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Wasserversorgung und das Risiko von Naturkatastrophen wie Dürren oder Überschwemmungen haben.
The ocean has taken some significant strides toward La Niña thresholds in recent weeks 📉
— Ben Noll (@BenNollWeather) September 14, 2024
Trade winds have been much stronger than normal, causing upwelling of cooler, sub-surface waters.
This year, the sub-surface is quite a reservoir of cooler than average water, primed to be… pic.twitter.com/F76Fr3x53q
Für Europa und insbesondere den deutschsprachigen Raum sind die Auswirkungen weniger eindeutig. Die direkten Einflüsse von La Niña auf Europa sind nicht so ausgeprägt wie in Nordamerika, dennoch können indirekte Auswirkungen auf die Wettermuster beobachtet werden. Einige Studien deuten darauf hin, dass während La Niña-Jahren eine Tendenz zu kälteren Wintern in Nordeuropa besteht. Für Mitteleuropa, einschließlich Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind die Effekte jedoch weniger klar definiert und können von Jahr zu Jahr variieren.
#winter2425 winter pressure pattern during La Niña years, with the QBO going from easterly to westerly, just like this year. Again, we can see a very clear negative NAO pattern,
— PV-Forecast (@PvForecast) September 12, 2024
source https://t.co/3Z5ppWc9Y5 pic.twitter.com/b7Sb6VCENA
Im deutschsprachigen Raum könnte dies zu einer erhöhten Variabilität der Winterwettermuster führen. Das bedeutet möglicherweise Perioden mit intensiver Kälte, gefolgt von ungewöhnlich milden Phasen. Es ist wichtig zu betonen, dass lokale Wetterbedingungen trotz übergreifender Trends stark variieren können. Die potenzielle Rückkehr von La Niña folgt auf ein starkes El Niño-Ereignis, was eine bedeutende Verschiebung globaler Wettermuster markiert. Diese Transition könnte weitreichende Folgen für globale Temperaturen und extreme Wetterereignisse haben.
First look at the Winter 2024/2025 forecast for U.S., Canada and Europe, and the potential impacts of a weak La Niña and the Polar Vortex
— Climate Realists🌞 (@ClimateRealists) August 26, 2024
Source: Severe Weather Europe https://t.co/kaJSVzj1lM
Interessant diesbezüglich ist auch die deutliche Abkühlung des Wassers im nördlichen Atlantik infolge eines schwächer werdenden Golfstroms. Der Golfstrom und die gesamte atlantische Zirkulation (AMOC) zeigen seit Jahrzehnten eine stetige Abschwächung, so ein detaillierter Bericht. Hauptursache dafür ist wahrscheinlich ein verstärkter Zustrom von Süßwasser durch das Schmelzen arktischen und grönländischen Eises. Dies führt zu einer Verringerung des Salzgehalts im Nordatlantik, wodurch das Oberflächenwasser weniger dicht wird und nicht mehr so leicht in die Tiefe sinken kann. Dadurch verlangsamt sich die gesamte Strömung. Konkrete Auswirkungen sind bereits sichtbar: Während sich das Wasser entlang der US-Ostküste erwärmt, kühlt der nördliche Atlantik ab. Diese Temperaturmuster stimmen mit Modellsimulationen einer sich abschwächenden AMOC überein.
The AMOC warm-water pipeline (Gulf Stream) is down by more than 25% fro,m 100 years ago. EU will have many more cold "blasts" until the AMOC fails. Same conditions that froze Mammoths with buttercups in their stomachs, undigested. D-O Event on the way. https://t.co/wzSSLgmuCH
— Sam Iam (@hello_sam_) September 14, 2024
Eine vollständige Unterbrechung der Strömung hätte weitreichende Folgen für das globale Klima. Simulationen zeigen, dass dies zu einer deutlichen Abkühlung auf der Nordhalbkugel führen würde, mit kälteren Wintern in den USA und Europa sowie Veränderungen der Niederschlagsmuster. Auch ohne kompletten Zusammenbruch hat die Verlangsamung bereits jetzt Auswirkungen: An der US-Ostküste staut sich wärmeres Wasser, was das Potenzial für Sturmfluten erhöht und mehr “Treibstoff” für Hurrikane liefert. Für Europa könnte es Veränderungen in der Zugbahn und Stärke von Tiefdruckgebieten bedeuten. Obwohl dadurch keine neue Eiszeit droht, werden die klimatischen Veränderungen durch die Abschwächung der Meeresströmung voraussichtlich noch in diesem Jahrhundert spürbar sein.